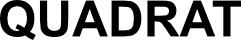Skulpturenpark
Der Skulpturenpark liegt im Bottroper Stadtgarten. Er ist Teil der Parklandschaft und befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Museumsbau. Etwas abseits der Innenstadt ist er zu jeder Jahreszeit ein Erholungsort.
Skulpturenpark des Museumszentrum Quadrat
Angelegt wurde der Stadtgarten schon 1921 und hatte die Eigenheiten eines englischen Landschaftsgartens zum Vorbild. Dies zeichnet sich durch kurvige Wege, die zum Schlendern einladen, sowie Blickachsen auf Brunnen oder Gebäude aus.
Seit 1976 ist das Museumszentrum Quadrat Teil dieser Parklandschaft. Der Museumskomplex wurde 1983 durch das Josef Albers Museum sowie 2022 durch den Neubau erweitert. Seine geometrische Architektur aus Beton, Stahl sowie großzügigen Glasfenstern bildet einen Kontrast zur reichen Vegetation der Umgebung. In diesen Kontrast fügen sich die mehr als 15 Kunstwerke aus unterschiedlichen Materialien ein. Bei ihrer Betrachtung wird die Verbindung von Kunstwerken, Museumsbau und Parklandschaft immer wieder neu verhandelt.
Nachfolgend finden Sie zu einigen Skulpturen einen kurzen Infotext. Weitere Texte werden zukünftig ergänzt.
Das Museums-Team wünscht Ihnen einen eindrucksvollen Rundgang.
Max Bill: Einheit aus drei gleichen Volumen
Drei gleiche Quader stehen ineinander verschachtelt, sie öffnen sich nach Oben. Als Material entschied sich der Künstler für Chrom-Nickel-Stahl. Alle Hinweise auf die Herstellung sind durch die hochglanzpolierte Oberfläche verschwunden.
Wenn Sie das Kunstwerk umkreisen, eröffnen sich immer wieder neue überraschende Ausschnitte auf die Umgebung. Mit Hilfe der Spiegelungen macht der Künstler die Beziehung von Kunst, Natur und uns als Betrachter*innen umso deutlicher.
Die Arbeit "Einheit aus drei gleichen Volumen" entwarf Max Bill 1978. Im gleichen Jahr fand eine Ausstellung des Künstlers im Quadrat statt. Bill gehört zu den Zürcher Konkreten. Wie Josef Albers studierte er am Bauhaus in Dessau. Als er die Ulmer Hochschule für Gestaltung gründete und die Direktion übernahm, lud er Albers 1953 als Gastdozent ein.
Walter Dexel: Lichtsäule II
Walter Dexels Lichtskulptur begegnet den leuchtenden Grün- und erdigen Brautönen des Skulpturenparks ebenfalls mit kräftigen Farben. Die Grundfarben Blau, Gelb und Rot sowie die Nicht-Farben Schwarz und Weiß heben sich deutlich von der Umgebung ab. Auch im Dunkeln: Denn die Kuben sind von innen beleuchtet.
Während seiner Bauhauszeit widmete Dexel sich Fragen von Stadtbau und Werbung. Aus den leuchtenden Werbungen der Städte entwickelte er autonome Lichtkunst. Dabei bezieht er sich immer wieder auf eine geometrische Formensprache. Bei dieser Skulptur stapelt er die unterschiedlich großen Kuben, mal liegend, mal stehend. Sie treffen auf ein ausbalanciertes und harmonisches Gesamtbild. Seine Lichtskulpturen erinnern an die flächigen Malereien von Piet Mondrian, doch übersetzt Dexel diese gekonnt ins Dreidimensionale.
Friedrich Gräsel: Raumplastik III
Streng und ruhig begegnen Ihnen der Würfel und die sich kreuzenden Flächen vor dem Eingang des Museums. Die beiden Elemente aus schwarzlackiertem Stahl werden in der Mitte durch eine Bodenplatte verbunden. Die Kanten des Würfels sind jeweils einen Meter breit. Das Kreuz nimmt dieselbe Grundfläche ein und verkörpert eine andere Art, den Raum auszufüllen. Die Bodenplatte hat dieselben Maße. Der Raum darüber ist frei. Er wird aber durch die anderen beiden Elemente begrenzt. Wie wirken die drei Elemente auf Sie?
Friedrich Gräsel wurde 1927 in Bochum geboren. Er arbeitete zeitlebens im Revier. Mit seinen Werken im öffentlichen Raum erkundete er verschiedene Räume in der Skulptur. Er beschäftigte sich mit der lokalen Industrie und nutzte oft Materialien wie Stahl oder Beton. Auch die Formen seiner Plastiken orientieren sich an der Industrie, ohne diese abzubilden. Die Formen ergänzen die industriell geprägten Orte des Ruhrgebiets. Er lädt uns ein, das Zusammenspiel von Industrie, Ort und Plastik zu beobachten.
Ernst Hermanns: Zwei gegeneinander verschobene Halbkugeln
Die matte Oberfläche aus Chrom-Nickel-Stahl nimmt vage Eindrücke der Umgebung und des Lichts auf. Platziert vor dem Eingang des Museums ist sie unmittelbar Teil der Museumslandschaft und fügt sich zwischen dem Museumsgebäude, der Straße und den Bäumen ein.
Minimiert auf den Körper einer in zwei geteilten Kugel behandelt die Plastik den Zusammenhang von Dynamik, Volumen und Räumlichkeit. Wenn Sie die zwei Halbkugeln betrachten, scheinen diese der Schwerkraft zu trotzen. Eine Halbkugel sitzt leicht versetzt nach oben auf der anderen und trotzdem gleitet diese nicht herunter. Welche Gefühle breiten sich in Ihnen aus, wenn Sie die instabile Komposition betrachten?
Ernst Hermanns ist 1914 in Münster geboren und studierte in Aachen, Düsseldorf und Paris. 1948 gründete er unter anderem mit Emil Schumacher die Künstlergruppe „junger westen“ in Recklinghausen. Während seiner Zeit als Professor an der Kunstakademie Münster entstand 1977 die 270 x 250 x 250 cm große Plastik. 2005 fand die Einzelausstellung Ernst Hermanns. Skulpturen im Quadrat Bottrop statt.
Nobert Kricke: Große Kurve I
Das breite Edelstahlrohr scheint sich zu bewegen, während Sie die Plastik umkreisen. Je nach Blickwinkel verändern sich die Wölbungen und Krümmungen und fügen sich immer neu in die Umgebung ein. Der Rhythmus der Wellen spiegelt Ihre eigene Bewegung. Ganz leicht fließt die Linie durch den Raum, körperlos, formlos. Beinahe vergessen Sie die Schwerkraft, die die Parklandschaft rund herum zusammenhält.
Die Edelstahl-Plastik ist über 6 Meter lang und stammt aus dem Jahr 1980. Im gleichen Jahr fand auch eine Ausstellung der Kunst Norbert Krickes im Museumszentrum Quadrat statt. Kricke lebte zwischen 1922 und 1984 und gehört zu den wichtigsten Vertreter*innen der deutschen Nachkriegsmoderne. Wie auch andere Bildhauer*innen dieser Zeit versuchte der Künstler, den Raum selbst sichtbar zu machen, ohne ihn auszufüllen oder zu umschließen. Statt schwerer, ausgefüllter Formen, nutzt Kricke eine Linie, die Bewegung darstellt und so den Raum bespielt.
Walter Leblanc: Archetype
Kreis, Quadrat und Dreieck stehen Ihnen direkt gegenüber, verdecken sich gegenseitig. Wie beziehen sich die drei Grundformen aufeinander? Von dem Quadrat ist nur eine Hälfte, ein Dreieck, zu sehen. Dies wiederum verdeckt ein Viertel des Kreises. Denken Sie sich nun die Überlappungen der Formen dazu, entstehen aus den drei Grundformen weitere Flächen. Für Walter Leblanc liegen diesen Formen Bedeutungen zugrunde, die jeder Mensch von Grund auf versteht. Das Verständnis für jene grundlegenden Strukturen und Prinzipien wird an der Skulptur erfahrbar.
Mit einer Höhe von 235 cm ist die Skulptur etwas größer als der menschliche Körper. Sie gehört zu einer Reihe gleichnamiger Werke, die unterschiedliche Kombinationen der Grundformen zeigen. Die Skulptur besteht aus Cortenstahl und ist beständig, da nur ihre erste Schicht rostet. Die matte Oberfläche betont das natürlich wechselnde Licht im Park. Bei Sonnenschein erweitern die dunklen Schatten die geometrischen Formen.
Bernar Venet: Undeterminate Line
Bernar Venets „unbestimmte Linie“ beschreibt mehrere unregelmäßige Kreisformen mit einem Durchmesser von fast drei Metern. Mühelos, leicht und beweglich scheinen die Formen in den Luftraum gezeichnet, doch tatsächlich besteht die Skulptur aus mehr als zwei Tonnen unnachgiebigem, massivem Stahl.
Das Spiel von Leichtigkeit und Schwere, Flexibilität und Stabilität sowie Dynamik und Statik tritt durch die rotbraune Oberfläche der Skulptur vor dem Grün der Umgebung deutlich hervor.
Im Jahr 1987 widmete das Josef Albers Museum dem 1941 in Frankreich geborenen Künstler eine Ausstellung. Seitdem ist „Undeterminate Line“ Teil des Skulpturenparks des Museums. In Europa und den USA sind Venets Skulpturen häufig im öffentlichen Raum zu finden. Gar nicht weit entfernt, auf dem zentralen König-Heinrich-Platz in Duisburg, befindet sich eine weitere seiner großformatigen Arbeiten.
Ur- und Ortsgeschichte im Stadtgarten
Neben Skulpturen gibt es auch Objekte der Ur- und Ortsgeschichte zu entdecken: Diese befinden sich in der Nähe der alten Villa und der Eiszeithalle.
Findlinge
Die Sammlung von Findlingen stammt aus Funden rund um Bottrop. Ihre Herkunft liegt jedoch im Norden Europas, wo die Steine vor Millionen von Jahren entstanden. Vor etwa 200.000 Jahren – während der Eiszeit – transportierte die natürliche Bewegung der Gletscher die Gesteinsbrocken immer weiter in den Süden. Bottrop lag in dieser Zeit mehr als 100 Meter unter dem Eis. Als das Eis schmolz, blieben diese Findlinge zurück. Sie werden auch Fremdlinge oder Irrblöcke genannt.
Findlinge sind meist aus hartem Material wie Granit. Andere, weichere Gesteine wie Kalkstein werden seltener gefunden, weil sie leichter verwittern. Findlinge lassen sich auch heutzutage auf Feldern entdecken. Sie werden beispielsweise zur Dekoration von Gärten oder als Grabsteine verwendet.
Diese Steine zeigen uns, wie jahrtausendealte Prozesse die Landschaft heute noch immer prägen.
Lore
Die Lore ist ein Kohlenwagen aus dem Bergbau. Unter Tage – also im Bergwerk – beluden Bergleute Loren mit Kohle oder Abraum. Eine Lok transportierte das verladene Material aus dem Bergwerk heraus. Die Lore ist aus Eisen gebaut und hat stabile Räder, um möglichst viel Gewicht aus den engen Stollen zu bringen. Sie unterstützte die körperlich anstrengende Arbeit der Bergleute.
Bottrop war über 160 Jahre lang eine Bergbaustadt. Der Kohlebergbau brachte der Stadt viele Jobs. Das zog Tausende von Arbeitssuchenden aus Deutschland und anderen Ländern an, die hierherzogen und bis heute die Region prägen. Gleichzeitig verursachte die Montanindustrie Probleme für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.
Importierte Kohle und erneuerbare Energiequellen ersetzten nach und nach die lokal geförderte Kohle. 2018 wurde das Bottroper Bergwerk Prosper-Haniel als letztes aktives Steinkohle-Bergwerk in Deutschland geschlossen.
Heute steht die Lore als Symbol für die Zeit des Kohlebergbaus und die Arbeit der Bergleute.
Wollnashorn
Das Wollnashorn oder auch Wollhaarnashorn lebte in der Eiszeit. Sein Körper war an Kälte gut angepasst: Dichtes Fell, kurze Ohren und ein kurzer Schwanz verhinderten, dass es zu viel Körperwärme verlor. Mit seinem Horn konnte es sich verteidigen und auch Schnee und Erde wegschieben, um Nahrung zu suchen.
Haben Sie den Buckel auf den Schultern des Tieres entdeckt? Das sind kräftige Muskeln, die nötig waren, um den schweren Kopf zu stützen. Wollnashörner wogen bis zu 3.000 Kilogramm. Sie fraßen vor allem Gras und Kräuter.
Vor etwa 10.000 Jahren starben sie aus. Gründe dafür waren mutmaßlich die Jagd und Klimaveränderungen. Fossilienfunde zeigen: Wollnashörner lebten auch hier in Bottrop.
App zum Quadrat: Skulpturenpark - für Kinder
Auch für Kinder haben wir ein interaktives Angebot entwickelt:
Link zur App (Öffnet in einem neuen Tab)