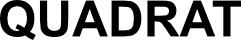50. Jahresausstellung Bottroper Künstler:innen
23. November 2025 bis 11. Januar 2026
Alle in Bottrop geborenen, ansässigen oder arbeitenden Künstlerinnen und Künstler haben einmal im Jahr die Gelegenheit, ihre Werke im Museumszentrum Quadrat zu präsentieren. Die Auswahl erfolgt durch eine Jury – zusammengesetzt aus Vertreter:innen der Stadt, Künstler:innen sowie Kunsthistoriker:innen.
Ausstellende:
Peter Beckhoff, Guido Berndsen, Louis Braun, Carsten Breuer, Claudia Brüggemeier, Rebecca Bujnowski, Wolfgang Fröhling, René Haustein, Susanne Herrnberger, Guido Hofmann, Martin Honert, Stephan Hütte, Ulrike Int-Veen, Marc-Andre Jäger, Roman Jäkel, André Kirschbaum, Pepe Klee, Christina Kleinheins, Thomas Köller, Frank Köthur, Renate Kraft-Mysliwietz, Regina Kreer-Ulbricht, Klaus J. Lach, Petra Lamers, Monika Lioba Lang, Andrea „Ada“ Leitner, Georg Märker, Odile Meier-Dusol, Peter Mrasek, Ralf Opiol, Petra Pauen, Wilma Reidick, Angelika Schilling, Barbara Schmuchal, Dieter Schröder, Paul Schulte, Kimberley Slickers, Max Spielvogel, Peter Steinebach, Hannah Sühling, Lisa Thesing, Sabine Tollkühn-Klein (KL.), Reimund Walther, Jutta Weber, Stefan Wepil, Reinhard Wieczorek, Gabriele Wilmsen, Trudel Zeltinger
Einzelpräsentation im Rahmen der Jahresausstellung
Gereon Krebber. Ins Grüne
Der Bildhauer Gereon Krebber (*1973) ist nach 2005 zum zweiten Mal mit einer Einzelpräsentation im Rahmen der Jahresausstellung Bottroper Künstler_innen im Museumszentrum Quadrat vertreten. Nach der Ausstellung „Kringel“ (2005), zeigt er unter dem Titel „Ins Grüne“ neue Arbeiten und mischt diese mit älteren Arbeiten, die aber zum Teil neu gegossen worden sind, um neue Situationen für den gegebenen Ort zu schaffen.
Die Jahresausstellung, seit Gründung des Museumszentrums 1976 fester Bestandteil im Ausstellungskalender, jährt sich 2025 zum 50. Mal. Die Jury nahm dies zum Anlass, den renommierten Künstler mit seinem unerschöpflichen Formenrepertoire ein weiteres Mal einzuladen.
Der inzwischen international bekannte Bildhauer Gereon Krebber ist seit 2012 Professor für Bildhauerei im Orientierungsbereich der Kunstakademie Düsseldorf. Dort studierte er selbst zwischen 1994 bis 2000 bei den Professor_innen Luise Kimme, Tony Cragg und Hubert Kiecol, bevor er von 2000 bis 2002 das Royal College of Art, London, besuchte, und mit dem MA Fine Art Sculpture abschloss.
Der Kulturpreisträger der Stadt Bottrop (2007) ist seit 2004 mit seinen Werken bei der Jahresausstellung vertreten. Doch schon vor seiner ersten Beteiligung erregte er im selben Jahr Aufsehen mit seinem Ausstellungsbeitrag zum 25-jährigen Bestehen des Künstlerbund Bottrop. Die Gelatinearbeit "Kreis" mit einem Durchmesser von sechs Metern bedeckte den Boden der Modernen Galerie. Seit dieser Zeit fanden aktuelle Werke aus allen erdenklichen Werkstoffen in jedem Jahr ihren Weg ins Quadrat. Zuletzt waren es keramische Arbeiten wie „Smavos“, „Dupper Boxen“ oder bereits 2022 eine Keramik aus der Serie „Derelikt“, die er mit heller Freude in Sichtachse zu dem soeben eröffneten Neubau platzierte und humorvoll mit den Worten "einstürzende Neubauten" kommentierte. Humor und Wortwitz begleiten das Œuvre Krebbers, die Titel und Wortschöpfungen sind elementarer Bestandteil seiner Kunst, wesentlich für den Dialog mit seinem Publikum. Niemals sind diese Titel eindeutig. „Es sind Fingerzeige und Fragezeichen, Fußangeln und Spielbälle – genauso wie die Skulpturen selbst“, so Krebber.
Mit „Ins Grüne“ ist Gereon Krebber der erste Künstler, der in der jetzt fünfzigjährigen Geschichte der Jahresausstellung, zwei Orte parallel bespielt. Es ist einerseits die dem Ort der Einzelausstellung zugedachte Studio-Galerie. Ein niedriger Raum im unteren Geschoss der Moderne Galerie, in den wenig Licht fällt. Andererseits sucht er die Weite des Vorplatzes und die von fünf Skulpturen der Museumssammlung, die sich bereits in unmittelbarer Nähe des Eingangsbereichs befinden.
Zwei Orte – innen und außen – wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Aus beiden schafft Krebber neue Situationen, trennt sie strikt und verbindet sie gleichzeitig. So sind seine Arbeiten oft monumental, immer eigenständig, gar autonom; eine jede steht für sich und ihre Gestalt ist vereinfacht. Ein Kontext entwickelt sich erst aus dem Zusammenspiel mit der Umgebung. Hierbei kommt der eigenen Wahrnehmung und der Erfahrung der Betrachtenden eine entscheidende Rolle zu. Ein assoziativer Prozess wird in Gang gesetzt und erschafft neue Erlebnisse.
Die Studio-Galerie wird vornehmlich durch vier Regalskulpturen bestimmt. In den Regalen hängen jeweils Bronzen und weitere Objekte. Der Ort wirkt verlassen, die Regale dearrangiert. Es entsteht unweigerlich eine fiktive und etwas surreale Keller- oder Lagersituation. Weitere Keramiken und Plastiken verstärken diesen Eindruck, lenken den Blick aber ebenso nach außen. Auf dem Vorplatz breiten sich die Skulpturen des Bildhauers wie eine begehbare Collage aus unterschiedlichen Materialien, Formaten, Formen und Oberflächen aus.
Gereon Krebber erzeugt mit seinen abstrakten Plastiken, Formen und Oberflächen beim Publikum Bildlichkeit. Assoziationen werden hervorgerufen, eingefahrene Sehgewohnheiten aufgebrochen. Als Künstler ziehen ihn Gegensätze an. Er setzt mit seinen Werken Kontraste, die er wiederum vereint; er setzt Kontrapunkte, die er verstärkt. Die Wahrnehmung entsteht in den Augen des Betrachtenden. Krebber gibt die Spielräume; die Welt ist niemals gut oder böse, sie ist immer alles zugleich. Sein Werk wird zu keiner Zeit langweilig für den, der es annimmt.